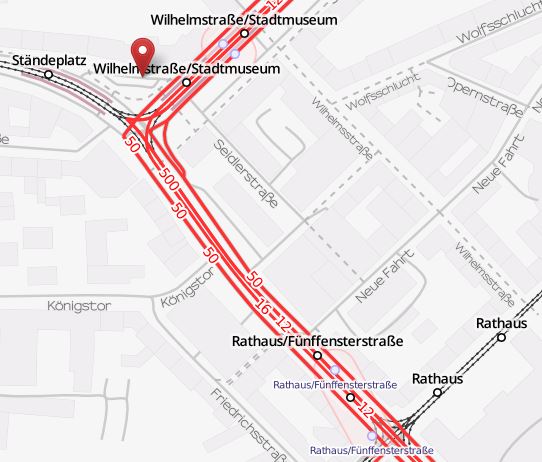- Zum Inhalt wechseln
- Direkt zur Hauptnavigation und Anmeldung
- Direkt zu den zusätzlichen Informationen
Nav Ansichtssuche
Navigation
Suchen
Der Autor unterscheidet offensichtlich nur zwischen Leidenschaft und Empfindsamkeit, ob dies ein Beitrag zu einer allgemeinen Theorie der „Männerfreundschaft“ sein könnte, bleibt dahingestellt. Was der General als Wahrhaftigkeit versteht, gründet letztlich doch nur auf Illusionen. So jedenfalls stehen die Chancen auf eine bessere Welt sehr schlecht und dem Menschen, ob Mann oder Frau, kann wohl auch nicht mehr geholfen werden. Trotzdem: Danke für den Versuch, Sàndor!
Zusätzliche Informationen
Adresse
Akademie 55plus Kassel e.V
Friedrich-Ebert-Strasse 4
34117 Kassel
Sprechzeit:
Jeden dritten Donnerstag im Monat von 10-12 Uhr
Tel.:0561-45018560
nur während der Sprechzeit
Information:
Tel mobil.:
01515-9865358 oder:
So kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmittel der KVG bzw. NVV zu uns:
Haltestelle: Ständeplatz ---> Straßenbahnlinien 4, 7 und 8,
Haltestelle: Wilhelmsstraße/
Stadtmuseum --> Bus-Linie 500, 510 sowie Regiotram
RT1 und RT5
Klicken Sie auf den Link: Fahrplanauskunft
und geben Sie Ihren Start(ort) und als Ziel:
Ständeplatz oder
Wilhelmsstraße/Stadtmuseum an.
Klicken Sie danach auf: [Verbindung suchen]!
Sie können auch die Ihnen genehme Zeit einstellen
indem Sie oberhalb von START auf die Uhr klicken.